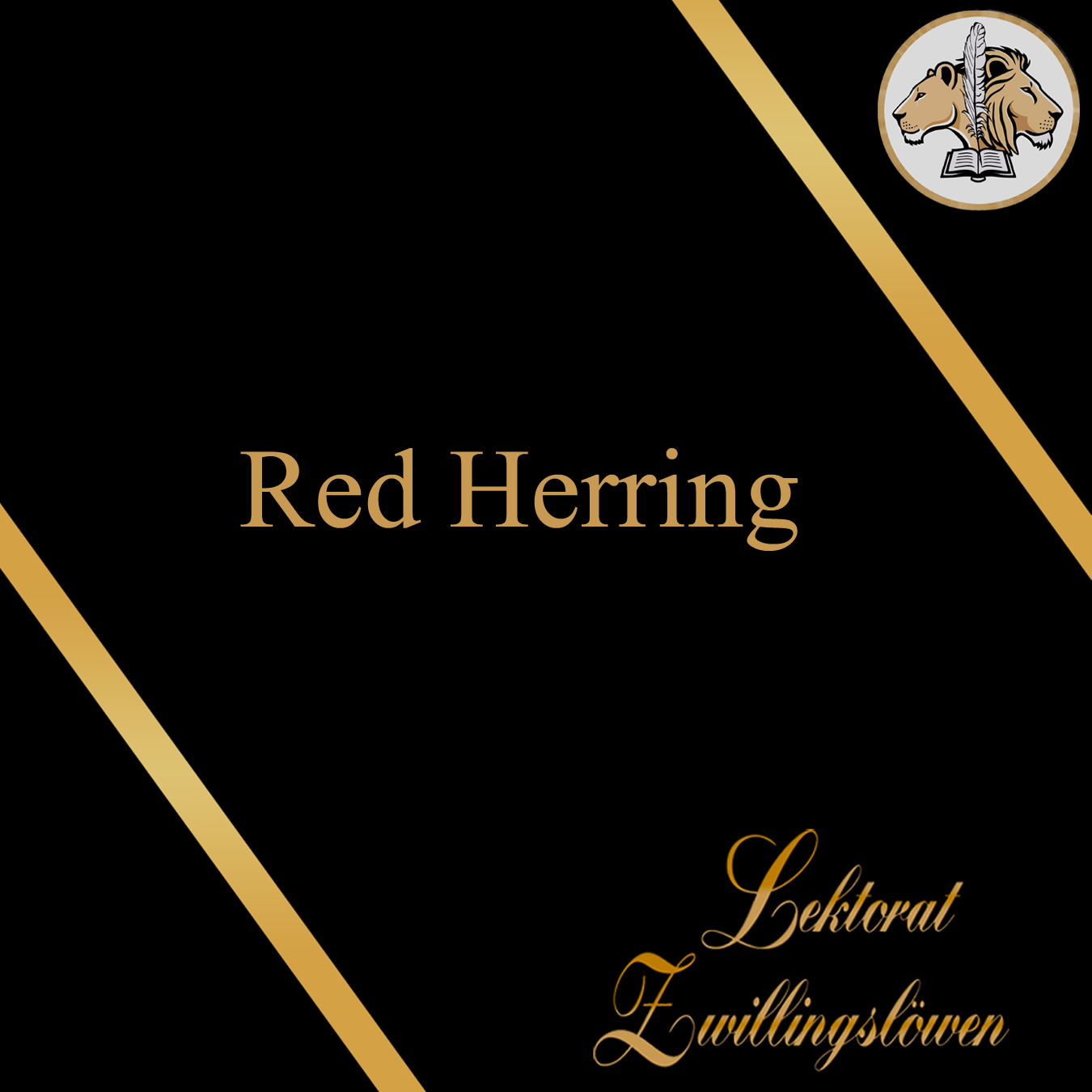
• Was ist ein Red Herring (roter Hering)?
Bei dieser Erzähltechnik handelt es sich ebenfalls um eine Art Foreshadowing, wobei der wesentliche Unterschied darin besteht, das Publikum bewusst in die Irre zu führen, indem man es auf eine falsche Fährte lockt.
Ursprünglich stammt diese Redewendung aus dem 17. Jahrhundert, dort wurde geräucherter Hering, der einen starken Geruch absonderte und eine rötliche Farbe besaß, dazu verwendet, um Jagdhunde von Wildtierspuren abzulenken.
Erst ab dem 19. Jahrhundert wurde dieser Begriff auch als Finte in der Rhetorik geläufig.
Das Ziel dieser Erzähltechnik ist es, Spannung zu erzeugen und zu überraschen, indem man die Erwartungshaltung des Publikums nicht bestätigt.
• Wie setzt man Red Herring am effektivsten ein?
Im Prinzip gelten hier dieselben Spielregeln wie beim normalen Foreshadowing.
Man sollte diese falschen Spuren weder zu offensichtlich noch zu verborgen auslegen, um auch wirklich sicherzugehen, dass der Köder vom Publikum geschluckt wird.
• Welche Arten gibt es?
Im Folgenden werden wir uns die fünf bekanntesten Arten von roten Heringen ansehen und dazu jeweils ein Beispiel geben.
– The Whodunit (Wer hat es getan?):
Hierbei steht ein Mysterium oder ein anderes Geheimnis im Mittelpunkt. In Krimis ist diese Technik besonders relevant, da hier meistens nach dem Täter gesucht wird.
Beispiel: In Harry Potter und der Stein der Weisen wird Professor Snape von den Kindern verdächtigt, es auf das Artefakt abgesehen zu haben. Erst kurz vor Schluss klärt sich auf, dass er den Stein beschützt hat und in Wahrheit der unscheinbare und stotternde Professor Quirrell dahintersteckt.
– Unreliable narrator (Unglaubwürdiger Erzähler):
Die Wahrnehmung der erzählenden Figuren ist widersprüchlich/getrübt, sodass ihre Geschichte für die Leser unglaubwürdig erscheinen kann. Gründe hierfür können bewusste Täuschungen, psychische Störungen, Unwissenheit oder Voreingenommenheit sein.
Beispiel: Das Buch Life of Pi, in dem der namensgebende Protagonist zusammen mit einigen Tieren kentert und dann seinen Überlebenskampf schildert. Da Pi die Geschichte in zwei verschiedenen Versionen erzählt, leidet seine Glaubwürdigkeit, sodass für den Leser bis zum Ende nicht ganz klar wird, welche der Varianten der Wahrheit entspricht.
– Emotional Effect (Emotionaler Effekt):
Hierbei sollen durch falsche Hinweise die Emotionen des Publikums geweckt werden, häufig werden hierfür vermeintliche Charaktertode genutzt.
Beispiel: Die Serie The Walking Dead, in welcher der ursprüngliche Protagonist Rick Grimes sich in einer scheinbar ausweglosen Szene selbst opfert, um seine Freunde zu retten. Erst einige Staffeln später wird dieser emotionale Moment revidiert, indem enthüllt wird, dass der Charakter doch überlebt hat.
– Historical Subversion (Historische Irreführung):
Historische Fakten vermitteln dem Publikum normalerweise bereits den Ausgang einer Geschichte, aber anstatt diese eins zu eins umzusetzen, wird hier mit ihnen gespielt. Details werden angepasst, sodass reale Ereignisse in solch einer Nacherzählung womöglich anders ablaufen, als es in Wahrheit passiert ist.
Beispiel: Der Film Gladiator basiert zwar auf realen Gegebenheiten, aber weder die Darstellung der Gladiatorenkämpfe noch Kaiser Commodus sind wirklich historisch akkurat nacherzählt.
– Falsche Erwartungshaltung wecken:
Besonders im Marketing vor dem eigentlichen Erscheinungstermin wird das Publikum häufig hinters Licht geführt. Es fängt bei einem Buchcover oder einer Leseprobe an und hört bei Triggerwarnungen oder sogenannten Tropes auf.
Auch in Filmen oder Spielen kommt diese Methode sehr oft durch Teaser oder Trailer zur Geltung.
Beispiel: Der Trailer von The Last of Us 2 vermittelt einen ganz anderen Eindruck als das Computerspiel, da ein wichtiger Charakter relativ am Anfang das Zeitliche segnet.